Empörung ist längst keine Reaktion mehr – sondern Reflex, Markenzeichen, Geschäftsmodell. Und manchmal Ventil für alles, was sonst nicht mehr gesagt werden darf. Wer sich heute nicht empört, gilt schnell als naiv, abgestumpft oder – schlimmer noch – als undifferenziert.
Empörung ist heute billig zu haben. Ein Tweet, ein Ausschnitt, ein flüchtiges Zitat ohne Kontext – und schon lodert das Feuer. Empörung braucht keine Argumente. Sie braucht nur ein Publikum. Und als Wichtigstes: ein Feindbild.
Natürlich – es gibt vieles, über das man sich aufregen kann und soll. Ja, man muss es sogar. Aber diese permanente Verfügbarkeit der Empörung hat ihren Preis: Wenn alles Skandal ist, dann ist am Ende nichts mehr wirklich empörend. Der Unterschied zwischen Kritik und Kampagne, zwischen moralischem Impetus und moralischer Überheblichkeit verschwimmt. Und damit auch die Fähigkeit, Maß zu halten – oder einfach zu sagen: „Ich denke darüber nach“.
Lassen Sie mich ein Beispiel geben: Ein Politiker sagt in einem Interview einen unbedachten Satz. Innerhalb weniger Minuten geht der Hashtag hoch. Empörung von links, Empörung von rechts – und dazwischen das mediale Dauerfeuer. Kaum jemand liest das ganze Interview, noch weniger fragen nach dem Zusammenhang. Die eigentliche Aussage? Geht unter. Statt einer kultivierten Debattenkultur erleben wir Empörungsroutine mit der Berechenbarkeit eines Wetterberichts.
Die Logik dahinter ist simpel – und doch so unglaublich wirksam: Wer Empörung sät, der erntet Reichweite. Und wer Reichweite hat, wird für relevant gehalten – völlig gleichgültig, wie leer der Gedanke dahinter ist. Politische Kommunikation folgt dieser Dramaturgie zunehmend: laut, auf den Punkt zugespitzt, moralisch stets überlegen. Wer fragt, statt zu verurteilen, gilt als zögerlich. Und wer differenziert, steht gleich von Anfang an auf verlorenem Posten.
Doch das hat Folgen: Denn wo alles nur noch pure Empörung ist, wird Widerspruch zum Angriff. Und wer angreift, wird hart bestraft – nicht mit Argumenten, sondern mit Abwertung. So verengt sich der Raum des öffentlichen Diskurses, bis nur noch die Wahl zwischen Zustimmung oder Ablehnung bleibt. Dazwischen existiert nichts anderes mehr. Keine Grauzone. Kein Nebensatz. Kein ruhiges und besonnenes „Aber was, wenn doch?"
Der Preis dafür ist immens: Die soziale Spaltung vertieft sich, die Dialogfähigkeit erodiert. Und aus Meinungsfreiheit wird schließlich Meinungsdruck: Sag etwas – aber sag es gleich. Und vor allem: Sag es laut!
Tante Erni sagt dazu immer: „Also bitte – ich hab ja nix gegen Emotionen, aber das is ka Diskurs mehr, das is a Theater.“ Damit liegt sie nicht ganz falsch: Denn wer sich ständig empört, hat keine Kraft mehr für eine echte Auseinandersetzung. Und vielleicht auch gar kein Interesse daran.
Dabei ist Empörung per se nichts Schlechtes. Ganz im Gegenteil. Sie kann Weckruf sein, Stachel oder Motor. Aber sie verliert ihre Kraft, wenn sie zum Dauerzustand verkommt und jedes noch so leichte Kopfschütteln gleich gröblich verteufelt wird.
Was wir brauchen, ist wieder mehr Demut im Denken. Etwas mehr Mut zur Ruhe vor dem Urteil. Die Größe, etwas zuzulassen und auszuhalten, was uns gehörig gegen den Strich geht. Denn nicht jede Zumutung ist gleich ein Skandal und nicht jeder Widerspruch ein gefährlicher Angriff.
Empörung mag laut sein. Gefällig und griffig. Aber sie ersetzt nicht das Nachdenken.
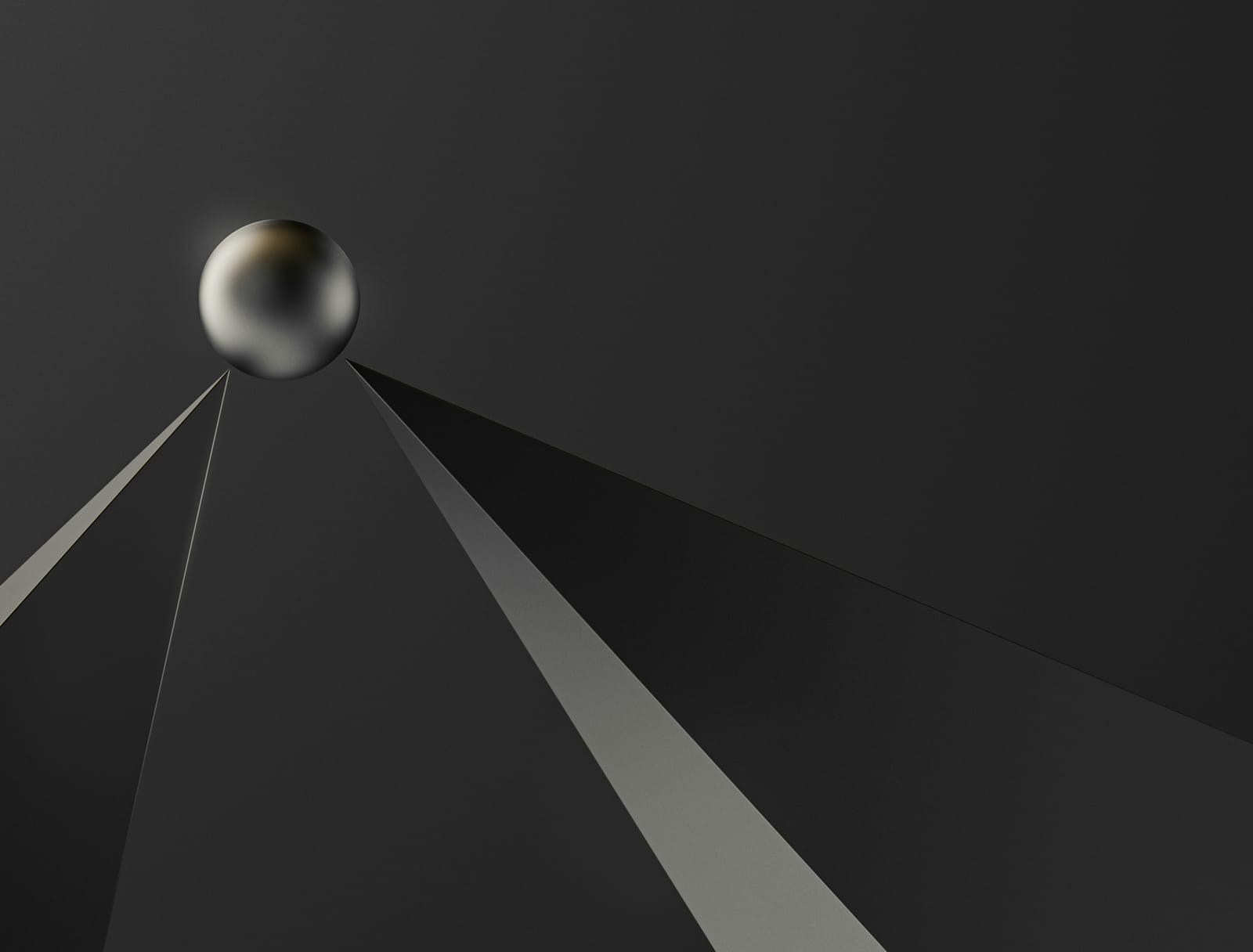
Mitgliederforum
Sie müssen sich als Mitglied registrieren, wenn Sie hier auf gedankenwelten.blog kommentieren möchten. Die Mitgliedschaft für die Kommentar-Funktion ist kostenlos und verpflichtet Sie zu nichts!