Auf einer Social-Media-Plattform fiel mir vor Kurzem ein Post auf: Ein Jugendlicher im ersten Lehrjahr beklagt sich darin über Boreout. Nicht über Burnout durch permanente Überlastung. Sondern über Boreout, also permanente Unterforderung. Seine Lage scheint ernst, die Worte klingen für mich ehrlich: "Ich will nichts faken, mir geht's wirklich dreckig."
In diesem Post bittet er die Community um Hilfe. Was mich so verblüfft, ist nicht die Tatsache, dass er es tut, sondern worum es ihm dabei geht – und welche Antworten er bekommt.
Doch der Reihe nach.
Es ist nicht nur der inhaltliche Aspekt des Posts, der mich fesselt. Es ist auch die Art, wie hier ein junger Mensch über seine Situation spricht – in einer Sprache, die nicht nur das beschreibt, was passiert, sondern auch sichtbar macht, was fehlt: Verbindung, Sinn, ein Platz im System, in der Gemeinschaft. Und die erahnen lässt, wie tiefgreifend die Folgen dauerhafter Unterforderung sein können:
"Ich bin den Großteil der Zeit einfach unterfordert - 70% sitze ich nur rum, hänge am Handy, weil es nichts zu tun gibt. Ich lerne absolut nichts, und die Aufgaben, die ich mal kriege, könnte jede*r machen, auch komplett ohne Erfahrung. Es fühlt sich alles sinnlos an."
"Mein Ausbilder hat keinen Durchblick, teilweise gibt es komplette Tage, an denen wir nicht mal ein Wort miteinander reden. Ich hab echt das Gefühl, ich versauere."
"Das Ganze hat sich auf meine Psyche gelegt: Ich entwickle langsam einen Boreout, fühl mich innerlich leer, unruhig, oft gestresst - obwohl ich den ganzen Tag eigentlich nichts mache."
"Ich merke auch, dass ich im Privatleben immer gereizter und antriebsloser werde. Ich hab auf gar nichts mehr Lust, mache zuhause einfach gar nichts. Selbst Dinge, die mir früher Spaß gemacht haben, fühlen sich wie Ballast an."
"Und trotzdem hab ich manchmal abends diesen Gedanken: 'Morgen wird easy, musst ja eh nichts machen.' Aber wenn ich dann da bin, hasse ich alles, diese leere Zeit, dieses Nichtstun, das mich langsam kaputtmacht.“
Doch der Jugendliche belässt es nicht bei der Schilderung seiner Lage und Gefühle. Er stellt auch eine konkrete Frage an die Community: „Wie schaffe ich es, mich für mindestens zwei Wochen krankschreiben zu lassen?“
Die Frage findet Echo. Die Antworten sind teils mitfühlend, teils robust. Konstruktive Vorschläge finden sich ebenso wie warnende Stimmen: „Halte auf jeden Fall durch, denn ein Lehrabbruch könnte auch der Beginn eines beruflichen Absturzes schon ganz zu Beginn werden!“ Oder: „Eine Lehre abzubrechen ist so ziemlich das Schlimmste, was man in einem Lebenslauf lesen kann – sofern man nicht nahtlos in einer anderen Lehre weitermacht. Davon rate ich dringendst ab!“
"Wie schaffe ich es, mich für mindestens zwei Wochen krankschreiben zu lassen?" Es ist etwas an dieser Frage – und einigen der Reaktionen –, das mich mich nicht loslässt. Nicht, weil jemand ausgerechnet auf Social Media seine schwierige Situation offen darlegt. Sondern weil sich darin etwas zeigt, das weit über diesen Post hinausreicht. Etwas, das viele Fragen aufwirft.
Einigen davon gehe ich im Folgenden nach.

Warum genau diese Frage?
Warum nicht: Habt Ihr eine Idee, eine Lösung für mich?
Etwas an der Frage dieses jungen Menschen irritiert mich in mehrfacher Hinsicht. Nicht, weil sie unverständlich wäre – sondern weil sie so klar benennt, was nicht mehr geht, was nicht mehr auszuhalten ist, krank macht, die Lebensfreude raubt. Sie irritiert mich aber auch, weil sie nicht auf Veränderung zielt. Die Frage lautet nicht: Wie komme ich da schnellstens raus? Oder: Was würdet ihr an meiner Stelle tun? Sondern, in indirekter Form: Wie schaffe ich es, das für mich Unerträgliche noch länger auszuhalten?
Was hält einen Menschen, der spürt, dass ihn etwas kaputtmacht, in seiner Situation weiter fest? Was macht es ihm so schwer, eine andere Richtung zu denken – geschweige denn zu gehen? Warum fällt es ihm so schwer, einen klaren Schlussstrich zu ziehen und zu sagen: So kann ich nicht mehr, so will ich nicht mehr weitermachen?
Vielleicht steht hinter dieser Frage etwas anderes – stiller, aber mächtiger als jeder Leidensdruck: Angst vor dem Schritt ins Neue und damit Ungewisse. Angst, als schwach zu gelten in einer Welt, die immerwährende Stärke fordert, aber keinerlei Form der Schwäche duldet. Angst, nicht ernst genommen zu werden, wie er erkennen lässt: „Ich hab halt Schiss, dass der Arzt sagt: 'Du machst doch eh nichts – was stresst dich denn?'“
Was sagt es aus, wenn jemand diesen Satz überhaupt denken muss? Wie tief sitzt der Zweifel – und wie früh lernen Menschen, ihn für sich zu behalten? Zu verstecken vor allem und jedem?
Auch die Reaktionen auf diese Frage erzählen etwas. In ihnen stecken Fürsorge und Mitgefühl – kein Zweifel. Aber gerade deshalb werfen sie für mich Fragen auf: Warum ist das Durchhalten wichtiger als Gesundheit? Warum gilt ein Ausstieg aus dem Leid als Scheitern? Und welche der eigenen Ängste werden hier unbewusst mittransportiert und öffentlich gemacht?
Wiederholt sich in diesen Kommentaren genau das, was den jungen Menschen innerlich bindet? Dass man durchhalten muss, weil es sonst schlimmer kommt? Dass es besser ist, unglücklich zu funktionieren als ungewiss neu zu beginnen? Dass Anpassung vernünftig ist – und Veränderung riskant, nachteilig, beschämend?
Welche Bilder vom Leben stecken denn in der Frage selbst, aber auch in den Antworten darauf? Welche Vorstellungen von Stärke, von Erfolg, von Reife? Und wie tief sitzen diese Muster in uns allen – auch in jenen, die sie mit gutem Willen weitergeben?
Was haben wir als Gesellschaft übersehen? Und was übersehen wir immer noch? Was geben wir weiter, unausgesprochen – an Normen, an Vorstellungen vom Gelingen, an Maßstäben? Und was tragen wir bei als Eltern, als Lehrerinnen, als Ausbilder? Legen wir mit unseren Erwartungen die Messlatte so hoch, dass es für manche leichter ist, gar nicht erst zu springen?
Und warum sucht jemand ausgerechnet in einem sozialen Netzwerk nach Hilfe – dort, wo alles stark, klar, erfolgreich wirkt? Wo Perfektion das Maß aller Dinge ist? Wo Scheitern keinen Platz hat und findet? Und was bedeutet es, wenn ausgerechnet in der Welt der Selbstoptimierung ein Moment der Erschöpfung offenbar wird?
Aber vielleicht ist das Verstörende an diesem Post gar nicht die Frage selbst. Sondern dass alles so selbstverständlich klingt.
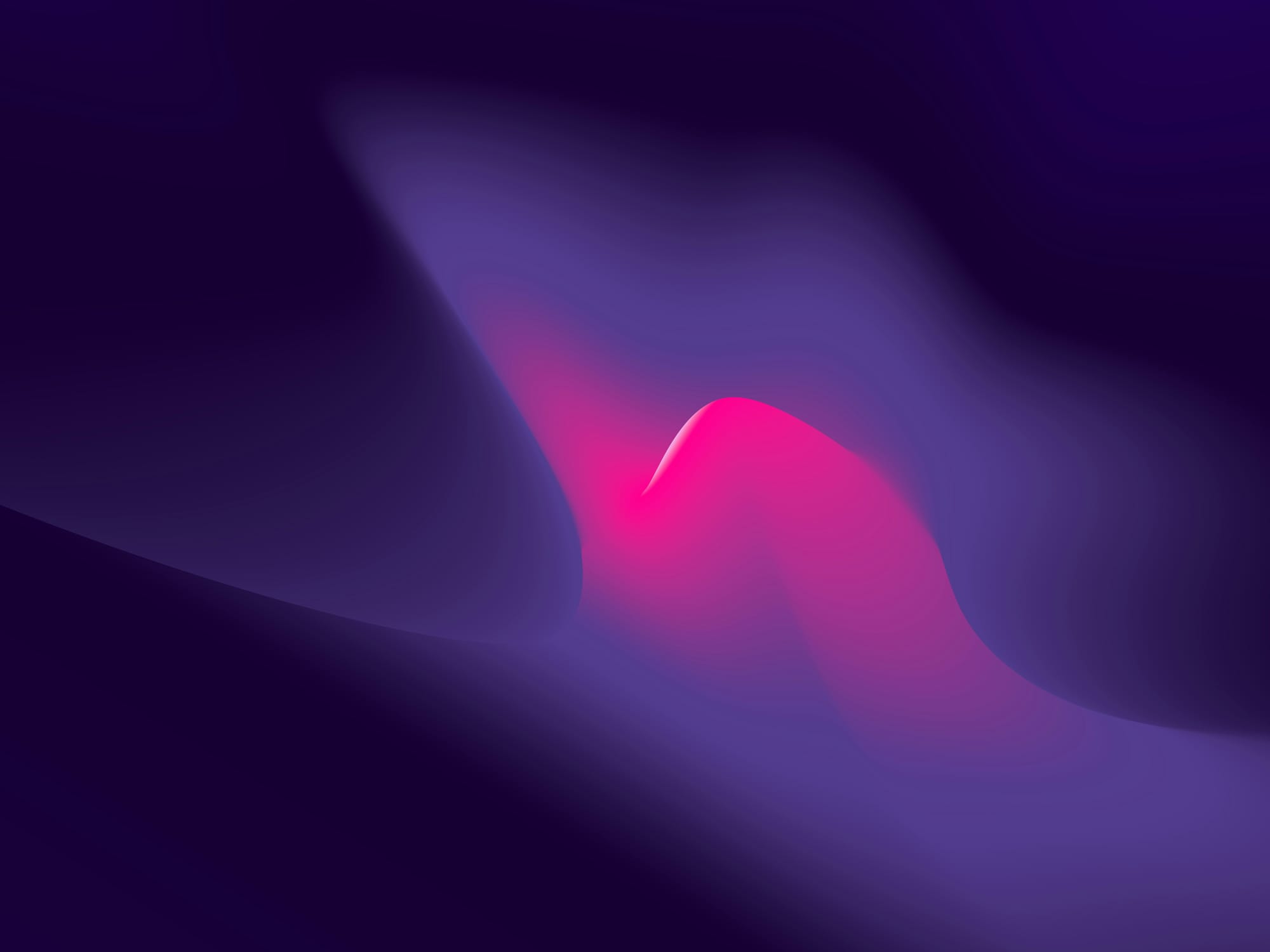
Wer trägt die Verantwortung dafür?
Hilflosigkeit entsteht nicht aus dem Nichts
„Wie schaffe ich es, mich für mindestens zwei Wochen krankschreiben zu lassen?“ Hinter dieser verzweifelten Frage steckt mehr als individuelle Erschöpfung. Sie entspringt – ebenso wie die Antworten darauf - einer problematischen Haltung, die tief in unserer Gesellschaft verankert ist.
Es ist eine Haltung, die auf Erfolg fixiert ist. Auf Leistung und Stärke. Auf makellose Lebensläufe. Auf Durchhaltevermögen und Härte zu sich selbst. Erst wenn der Körper streikt oder die Psyche kippt, ist Stillstand erlaubt – und dennoch entsteht daraus ein Stigma, ein lebenslanger Nachteil: Du bist schwach. Du hast es nicht geschafft. Du bist gescheitert.
Der junge Lehrling steckt in einem paradoxen Dilemma: Er erlebt täglich die Sinnlosigkeit seiner Ausbildung – und steht zugleich unter dem Druck, weiterzumachen. Nicht, weil er will. Sondern weil es von ihm nicht nur gefordert wird und weil es ihm sogar empfohlen wird.
Freilich könnte man nun fragen, warum er nicht selbst aktiv wird und sich um einen anderen Lehrplatz bemüht. Auch mir kam dieser Gedanke im ersten Ärger über sein passives Verhalten. Doch je öfter ich den Post und die Antworten las, und je länger ich über alles nachdachte, desto leiser wurde dieser Ärger.
Denn einerseits ist dem Unternehmen, das diesen Lehrling ausbilden soll, Versagen anzulasten: Wo kein erkennbarer Ausbildungsplan existiert, junge Menschen tagelang sich selbst überlassen bleiben, Ausbilder weder begleiten noch anleiten oder wahrnehmen, was unmittelbar vor ihren Augen passiert – dort entsteht kein Lernraum. Dort entfaltet sich keine Kompetenz, findet keine Entwicklung statt. Sondern Rückzug, der irgendwann in Verstummen und Erstarrung mündet.
Andererseits besteht für mich die Frage, ob man von diesem Jugendlichen etwas erwarten darf, das er vielleicht nie gelernt hat – nämlich für sich selbst einzutreten, aus Eigenverantwortung heraus zu handeln, Entscheidungen zu treffen und Verantwortung zu übernehmen – nicht weil man es muss, sondern weil man spürt, dass etwas nicht mehr stimmt. Wo solche Erfahrungen fehlen, bleibt oft nur das Verharren. Nicht aus Bequemlichkeit, sondern weil der nächste Schritt keinen Namen hat – und keine Richtung.

Was bleibt, ist Hilflosigkeit
Doch wie können wir das ändern?
Wer sich selbst nicht als handlungsfähig erlebt, hat meist gute, wenn auch unbewusste Gründe dafür. Diese entwickeln sich allerdings nicht erst im ersten Ausbildungsjahr – sondern in den vielen Lern- und Lehrjahren davor: in der Kindheit, im Klassenzimmer, im Elternhaus.
Was sich heute im Verhalten nicht nur eines jungen Menschen zeigt, hat seine Wurzeln in dem, was oft lange zuvor sein Selbstverständnis formte. Weil ihm Hindernisse und Schwierigkeiten aus dem Weg geräumt wurden, bevor er sie selbst erfassen, geschweige denn selbst bewältigen konnte. Weil es keine Erlaubnis gab, Fehler zu machen – weil diese nicht als wichtiges Lernfeld galten, sondern als Makel und Zeichen von Schwäche. Weil seine Anpassung belohnt wurde – nicht sein Versuch, etwas anders zu machen und eigene Wege zu erforschen. Weil die Zweifel an ihm und seinen Fähigkeiten lauter waren als jedes Zutrauen. Und weil Ermutigung ausblieb – und mit ihr die bewusst provozierte Chance, zu erleben, dass eigenes Handeln etwas bewirken kann.
Was daraus entsteht, ist keine bewusste Entscheidung – sondern erlernte Hilflosigkeit, die sich langsam über viele Jahre hinweg ausbildet und als fester Bestandteil der Persönlichkeit etabliert.
Der reflexhafte Ruf nach äußerer Hilfe ist unter diesen Bedingungen kein individuelles Versagen, sondern die logische Folge einer Sozialisation, die Autonomie zwar als Ideal proklamiert – ihre Entwicklung aber systematisch untergräbt: Wo Erwachsene alle Steine aus dem Weg räumen, lernen Kinder nicht, sie selbst beiseite zu schieben – oder über sie hinwegzusteigen.
Was wir an jungen Menschen so häufig als fehlende Initiative beklagen, haben wir in vielen Fällen selbst herangezogen: durch wohlmeinende Überbetreuung, durch Sicherheitsdenken, das jedes Risiko scheut, durch ein Leistungsverständnis, das keinen Raum für Umwege lässt.
Die Frage „Wie schaffe ich es, mich für mindestens zwei Wochen krankschreiben zu lassen?“ wird für mich so zum Symptom einer tieferliegenden gesellschaftlichen Störung. Sie offenbart die Diskrepanz zwischen dem, was wir jungen Menschen abverlangen – und dem, wozu wir sie tatsächlich befähigen.
Ein Ausweg aus diesem Dilemma beginnt nicht mit der Forderung nach Übernahme von mehr Verantwortung. Sondern durch die Schaffung von Räumen, in denen sie erprobt werden kann. Mit dem Recht auf Fehler. Mit echten Herausforderungen. Mit der geduldigen und zugleich zurückhaltenden Begleitung durch Eltern, Lehrer und Ausbilder, die Kontrolle durch Vertrauen und Zutrauen ersetzen – und so den Weg für eigene Erfahrungen freimachen.

Mitgliederforum
Sie müssen sich als Mitglied registrieren, wenn Sie hier auf gedankenwelten.blog kommentieren möchten. Die Mitgliedschaft für die Kommentar-Funktion ist kostenlos und verpflichtet Sie zu nichts!